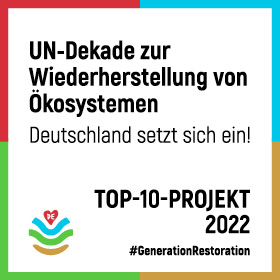Was sind erfolgreiche Konzepte zur Wiederherstellung artenreichen Grünlandes in Deutschland? Eine multiregionale Bewertung sozial-ökologischer Systeme und pilothafte Umsetzung (Grassworks)
Zielsetzung und Anlass des Vorhabens
Zielsetzung und Anlass des Vorhabens
In Grassworks wollen Forschende aus Ökologie, Nachhaltigkeitswissenschaften und Ökonomie zusammen mit dem Thünen-Institut als Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Politik und dem Deutschen Verband für Landschaftspflege in einem transdiszipliären Forschungsansatz untersuchen, welche Faktoren für eine erfolgreiche Renaturierung von Grünland entscheidend sind. In drei Regionen Deutschlands (Nord, Mitte, Süd) werden jeweils 30 bereits umgesetzte Renaturierungsprojekte einer Post-Hoc-Analyse unterzogen, um den Einfluss ökologischer, sozial-ökologischer und sozioökonomischer Rahmenbedingungen auf den Renaturierungserfolg zu quantifizieren und Hebelpunkte für mehr Biodiversität und Multifunktionalität zu identifizieren. Grassworks wird damit eine einzigartige Gesamtanalyse der direkten und indirekten Treiber des Renaturierungserfolgs von Grünlandökosystemen ermöglichen.
Komplementär hierzu werden in drei Reallaboren (Nord, Mitte, Süd) partizipativ mit relevanten Akteuren Maßnahmen geplant und in ausgewählten Gemeinden umgesetzt sowie gemeinsam Hebelpunkte identifiziert, die zu einer höheren Wertschätzung von Biodiversität, ÖSF und ÖSL und einem besseren Wissen über erfolgreiche Methoden der Grünlandrenaturierung führen können. Eine Analyse der ökonomischen und politischen Aspekte der Grünlandrenaturierung wird Stärken und Defizite identifizieren und Handlungsoptionen für eine Verbesserung der Governance auf unterschiedlichen Skalenebenen (inkl. AUKM in der GAP und andere Politikinstrumente) aufzeigen.
Über inter- und transdisziplinäre Modellierungen werden die vielfältigen Ergebnisse synthetisiert und fließen in ein innovatives Online-Informations- und Prognose-Tool für Grünlandrenaturierung. Die Initiierung eines forschungsbasierten Transformationsprozesses in den Reallaboren soll zu einer Verstetigung führen und auf andere Regionen übertragbar sein. Unsere innovativen Beratungsinstrumente werden die planerische, technische und ökologische Qualität der Umsetzung maßgeblich verbessern. Priorisierungen werden gesellschaftliche Entscheidungsprozesse auf geeigneten Standorten unter Berücksichtigung des Renaturierungsziels skizzieren (u.a. langfristige Kohlenstoffspeicherung, Erhöhung der Resilienz gegenüber Witterungsextremen, Förderung von Insekten, Erzeugung hochwertiger Futter- und Nahrungsmittel, kulturelle ÖSL).
Grassworks verfolgt einen sozial-ökologischen Systemansatz, der die Dynamik der Wertschätzung der Biodiversität explizit erfasst, Governance-Strukturen verbessert, Szenarien zukünftiger Politikinstrumente und Naturschutzstrategien entwickelt und damit entscheidend zum Schutz der Biodiversität im Grünland beiträgt.


Projektleitung:
Prof. Dr. Vicky Temperton (vicky.temperton@leuphana.de), Leuphana Universität Lüneburg
unter Beteiligung von Prof. Dr. Anita Kirmer (anita.kirmer@hs-anhalt.de), Hochschule Anhalt
Projektbeteiligte und Mitarbeitende Hochschule Anhalt:
Prof. Dr. Sabine Tischew (Sabine.Tischew@hs-anhalt.de)
Dr. Annika Schmidt, M.Sc. Line Sturm, M.Sc. Konrad Gray
Weitere Projektpartner:
Technische Universität München (Prof. Dr. Johannes Kollmann, Prof. Dr. Johannes Sauer)
Universität Greifswald (Prof. Dr. Volker Beckmann)
Thünen-Institut für Biodiversität, Braunschweig (PD Dr. Jan Thiele)
Deutscher Verband für Landschaftspflege (DVL) (Dr. Jürgen Metzner)
Gefördert durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung, Forschungsinitiative zum Erhalt der Artenvielfalt (FEdA)
Projektnummer: 16LW0095
Laufzeit: 11/2021 - 10/2024
Hier gehts zur offiziellen Projektseite